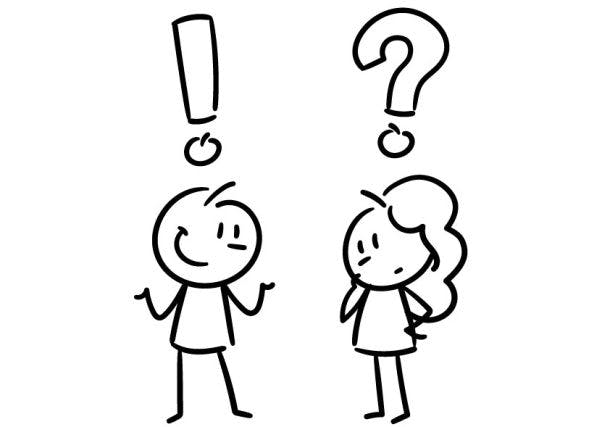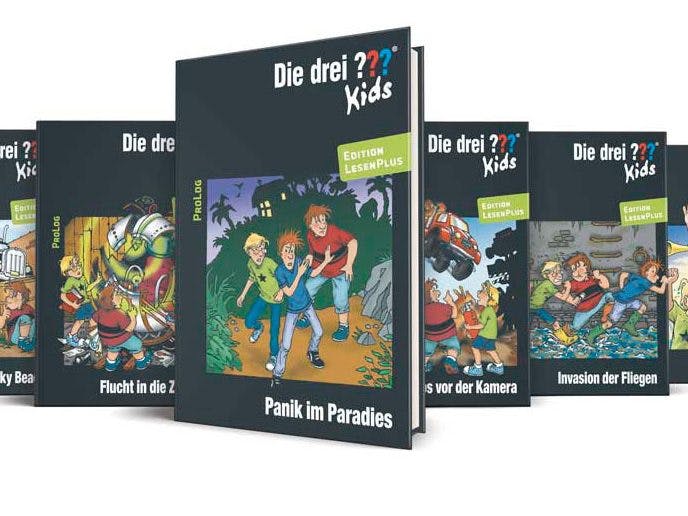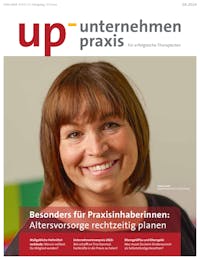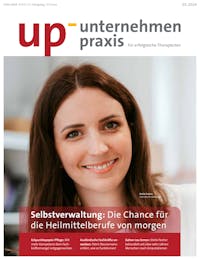Die nächsten Events
- up stammtisch online
Jeden Mittwoch 20 Uhr
Infos & Themen
Weitere Events
- Kurzseminar zum Thema Neue DGUV Rahmenverträge
19.10.2023 · 19 Uhr · online
Alle Neuerungen zur Behandlung von BG-Versicherten und UVT-Versicherten in 90 Minuten
Anmeldung hier